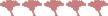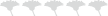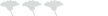Die bisherigen Einteilungen auf Olionatura waren für mich immer ein Provisorium – nicht falsch, aber sie trafen bisher nicht exakt das, was meine Erfahrungen und mein Wissen wiederspiegelt. Ich habe die letzten 3 Jahre viele Daten zusammengetragen, aus Dissertationen, wissenschaftlichen Fachartikeln, aus persönlichen Gesprächen mit deren Autoren, darunter Dr. Lautenschläger und Dr. Ansmann, dem »Vater« der Spreitkaskade. Gerade dieser persönliche Austausch hat mir wichtige Impulse gegeben.
Jetzt, im Kontext der Vorbereitungen für mein Buch, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, die Erkenntnisse aus diesem Fundus umzusetzen – nein, nicht in einer völligen Umkehrung bisheriger Systematiken, aber in Details. Dr. Ansmann vor allem hat mir Mut gemacht, eigene Kategorisierungen vorzunehmen. Fakt ist: im Bereich pflanzlicher Öle gibt es bisher keine Systematik, die ihre kosmetischen Eigenschaften über klischeehafte Aussagen hinaus beschreibt (die meistens von einander abgeschrieben sind, daher liest man oft das gleiche Falsche); ich kenne nur meine eigene.
Eine erste Änderung habe ich bereits vor Monaten vorgenommen, nämlich die Korrektur der Spreiteigenschaften von Pflanzenbuttern. Hier bin ich anfangs einem Irrtum aufgesessen: irrtümlicherweise führte ich die erhöhten Spreiteigenschaften von Avocadoöl auf die enthaltenen unverseifbaren Anteile zurück. Aus diesen schloss sich, dass sich dann auch phytosterolreiche Pflanzenbuttern in einer Emulsion als schnellspreitend erweisen müssten. Avocadoöl zieht tatsächlich schnell ein und »spreitet« haptisch betrachtet etwas besser als andere Öle, aber aus anderen Gründen.
Die Erfahrungspraxis mit verschiedenen Phytosterolpräparaten und mit Sheabutter selbst zeigte mir jedoch, dass sich das Auftragsverhalten und der Grad der wahrgenommenen Rückfettung mit zunehmendem Phytosterolgehalt verändern: die Emulsion wird reichhaltiger, wirkt rückfettender und liegt länger auf – typische Merkmale für langsam spreitende Lipide. Bei hohem Wassergehalt einer Emulsion wird es besonders deutlich: ein höherer Anteil an Sheabutter, kombiniert mit einem der gängigen langsamen Spreiter, zeigt haptisch eine deutliche Spreitlücke, die Emulsion tendiert zum Stoppen, »bricht auf«, es fehlt die Geschmeidigkeit. Hier sind es vor allem die gesättigten Fettsäuren, denn Traubenkernöl verhält sich ganz anders – es hat jedoch auch nur 4 % Stearinsäure. Meine Erfahrung ist: hoher Anteil an langkettigen gesättigten Fettsäuren plus Phytosterolen mindern die Pentrationsgeschwindigkeit und das Spreitvermögen, beide haben hohe Schmelzpunkte.
Fakt ist: die Nomenklatur der Spreiteigenschaften, d. h. die Unterteilung in niedrig- (= langsam), mittel- und hoch-(=schnell) spreitende Öle – auf unsere pflanzlichen Öle übertragen – zeigt, dass wir keine echten schnellen Spreiter haben. Das, was wir als »schnelle« bezeichnen (Squalan, Neutralöl, Kokos-, Babassuöl, Palmkernöl), sind nach Dr. Uwe Zeidler und Dr. Ansmann mittlere Spreiter. Die Kosmetikindustrie arbeitet u. a. mit Estern, die superschnell spreiten. Das ist der Grund, warum konventionelle Emulsionen so leicht und nichtfettend oder, wie Dr. Ansmann es bezeichnet, »elegant« wirken.
Fakt ist: Wir haben durchweg nur langsame, oder um es korrekt zu sagen, Niedrigspreiter. Auch Avocado-, Traubenkern-, Sesamöl kommen nach Zeidler und Ansmann nicht in den Bereich der mittleren. Buttern jedoch sind noch langsamer – diese Erkenntnis hat mich bereits vor Monaten dazu gebracht, die Spreiteigenschaften von Sheabutter und Co vermutlich unbemerkt von vielen
Nun denke ich weiter: schnelle Spreiter haben wir nicht. Aber innerhalb unserer Palette an verfügbaren Lipiden haben wir ebenfalls deutliche Sprünge in den Spreiteigenschaften. Um die Haptik unserer Emulsionen zu verbessern, bietet sich an, mit einer eigenen Systematik zu arbeiten, die die Öle neu nach unseren Gegebenheiten ordnet,
eine naturkosmetisch orientierte Systematik der Spreiteigenschaften pflanzlicher Lipide:
hochspreitend (naturkosmetisch schnelle Spreiter): Squalan, Neutralöl, Babassuöl, Kokosöl, Palmkernöl (und andere Öle mit kurzen/mittleren gesättigten C-Ketten von C8:0–C14:0)
mittelspreitend (naturkosmetisch mittlere Spreiter): alle Öle mit mittleren/langen ungesättigten C-Ketten ab C16:1/C18:1 (Mandelöl, Avocadoöl, Nachtkerzenöl usw.)
niedrigspreitend (naturkosmetisch langsame Spreiter): Pflanzenbuttern mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren und langen C-Ketten (ab C18:0), je nach Herkunft und Zusammensetzung auch Sheaöl.
Kurz: wir verschieben die Sprünge im Spreitverhalten einfach nach unten und nehmen extrem langsame Niedrigspreiter in die 3. Kategorie auf. Konsequenz daraus ist: wer besonders leichte, geschmeidige, nicht klebrige Emulsionen (Lotionen z. B.) wünscht, nimmt einen guten Anteil an Squalan, MTC-Fetten (Neutralöl), Kokosöl und Co, einen sehr geringen an Pflanzenbuttern und holt sich z. B. die Phytosterole und Lecithine aus Traube, Avocado und Sesam. Wenn eines dieser Öle drin ist, kann man auch auf die Sheabutter verzichten – wenn's ganz leicht, aber fluidisierend und verhorungsregulierend sein soll.
Im mittleren Pflegebereich können die Hochspreiter verringert, der »Mittelbau« verbreitert und gezielt geplant werden – trocknend, halbtrocknend, nicht trocknend, gemäß gewünschter Fettsäuremuster. Shea und Co sollten sich nicht zu breit machen, sonst stoppt es zu stark. Erst ab 35 % Fettphase sind höhere Pflanzenbutteranteile angenehm.
Rückfettende Emulsionen schöpfen aus dem Bereich der naturkosmetisch mittel und niedrigspreitenden Lipiden; die hochspreitenden dürfen in kleinen Anteilen für die notwendige Geschmeidigkeit sorgen – müssen aber nicht. Hier bewegt sich die eigene Erwartung an das Produkt deutlich Richtung »Rückfettung« und »Schutzfilm«.
In der Praxis machen wir das ja schon. Nur kann ich nun nach diesem Modell erläutern, warum ein Rezept von mir keinen mittleren Spreiter hat (weil ich weder Avocado- noch Sesam- noch Traubenkernöl verwendet habe) und es dennoch gut komponiert ist.
Was ist mit Phytosterolen und Lecithin?
Auch hier haben meine Recherchen der letzten 3 Jahre, verbunden mit meiner Praxis, Ergebnisse gebracht, die bisherige Annnahmen modifizieren.
Konzentriertes ungesättigtes Phosphatidylcholin ist stark fluidisierend und penetrationsfördernd – siehe mein Experiment mit einem Ölgel. Lecithin als Substanzgemisch in pflanzlichen Ölen besteht auch aus anderen Phospolipiden, darunter solchen, die diese penetrationsfördernden Eigenschaften nicht haben. Ihre fluidisierende Wirkung ist dennoch da, alleine durch die Freisetzung von Linolsäure bei Spaltung durch Lipasen in der Hornschicht. Interessanterweise zeigen sich in einer Studie Varianten von Ölen, denen das Lecithin entzogen wurde, als schneller einziehend als die mit natürlichem Lecithingehalt – erwiesen für Soja- und Weizenkeimöl. Lecithin in Ölen scheint also stärker rückfettend zu wirken und die Einziehgeschwindigkeit eher zu mindern. Fluidisierung und Penetrationsgeschwindigkeit sind zwei verschiedene Dinge.
Bei Phytosterolen in pflanzlichen Ölen ist es ähnlich: sie scheinen die Einziehgeschwindigkeit gemäß dieser Studie zu verringern. Isoliert hinzugesetzt (UdA, Phytosteryl Macadamiate, Gamma-Oryzanol) machen sie Emulsionen reichhaltiger, »dichter«, okklusiver. Aber: sie sind hautphysiologisch aktiv, bauen sich in die Lipidschichten ein, emulgieren hauteigenes Wasser – sie wirken in der Hornschicht. Sie gehören zu unseren wertvollsten Wirkstoffen, sozusagen.
Penetration: Geschwindigkeit und Tiefe
Neben der Penetrationsgeschwindigkeit müssen wir jedoch die Penetrationstiefe in Betracht ziehen: Kokosöl spreitet (in unserem naturkosmetischen Bezugsfeld) sehr schnell, zieht auch schnell ein – aber nicht tief. Seine kurzen C-Ketten schmiegen sich in die oberflächlichen Vertiefungen des Stratum corneum und erzeugen ein schnelles Gefühl der Glätte. Unser (naturkosmetisch mittelspreitendes) Mandelöl zieht langsamer ein, aber der hohe Ölsäureanteil, verbunden mit dem geringen Anteil angesättigten Fettsäuren, lässt sie sehr gut penetrieren (Stichwort »Kinkenstruktur«), zudem ist Ölsäure einer der Majorfettsäuren in der menschlichen Haut und interagiert mit den Barrierelipiden, so dass sie auf diesem Weg in tiefere Schichten des Stratum corneum gelangt. Das gilt allerdings nicht für alle ölsäurebetonten Öle: Erdnussöl liegt extrem lange auf, penetriert kaum, daher kann man es so gut zum langsamen Aufweichen (»Mazerieren«) von Babyschorf einsetzen.Tja, so einfach ist das alles nicht.
Aus diesem Grund möchte ich Lecithine und Phytosterolgehalte aus dem »naturkosmetischen Spreitmodell nach Olionatura« herausnehmen und unter kosmetischen Aspekten in ein ergänzendes Modell packen, zudem sie sehr spezifische Wirkeigenschaften haben. Die Kombination nach Spreitwerten ermöglicht u. a. eben, den Grad der haptischen Rückfettung, die Okklusivität, die Geschmeidigkeit des Auftragverhaltens zu steuern. Die Auswahl innerhalb unserer »naturkosmetisch mittleren Spreiter« ist dann eine Möglichkeit, dort gezielter nach Fettsäuremustern (hier eben auch nach Jodzahl und nichttrockmend, halbtrocknend und trocknend) zu gucken und sich leichtere oder reichhaltigere, schnell einziehende oder stärkere okkludierende Kombinationen zusammenzustellen – ganz wie die eigene Haut es braucht.
Last not least: die Diskussion um Konservierung von Produkten und Eigenstabilität unserer Öle haben mich die letzten Monate dahin geführt, auf eine oxidationsstabile Basis zu setzen – dies hat auch Konsequenzen auf die gesamte Zusammenstellung von Ölen. Wir handeln ja schon nach diesem Modell, aber ich möchte es eben gerne handfest verschriftlichen und in eine nachvollziehbare und transparente Systematik packen, ergänzt mit übersichtlichen Tafeln und Praxis-Hilfen. Es wäre die erste naturkosmetisch orientierte und begründete Systematik. Ich glaube, es ist Zeit dafür.
Auf Olionatura werde ich in den nächsten Wochen diese Erkenntnisse umsetzen und auch die Beschreibung des Spreitverhaltens insofern korrigieren, dass sich das Modell von Dr. Uwe Zeidler und das naturkosmetisch orientierte von Olionatura getrennt notiere. Ja, langer Beitrag