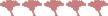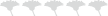Wilma hat geschrieben:Heike, bitte nicht missverstehen: ich wollte Dich nicht angreifen - Deine Kurzcharakterisierung der Rezepte auf Deiner Homepage als "frei von klassischen Emulgatoren" habe ich genauso aufgefasst wie sie angezeigt sind, nämlich als frei von klassischen Emus, aber halt nicht total Emu-frei.
Wilma, ich fühle mich in keiner Weise angegriffen.

Für mich ist es unstrittig, dass Lecithine, Lanolin, Wollwachsalkohole usw. Emulgatoren sind, teilweise mit gewissem Wirkstoffcharakter (Phosphatidylcholin, Sterole), teilweise primär emulgierend (Rein- und Lysolecithin). Es sind Emulgatoren.
Die Kernfragen von Dir und Anja (»… ist Emu-frei das wichtige Kriterium für Hautverträglichkeit?« und »Warum ist die Frage überhaupt wichtig? Um welche Hautprobleme geht es?«) zielen genau auf die Aspekte, die mich »treiben« – ein Blick in die Chemie der Stoffe (soweit mir das als Laie gelingt), in die Art, wie sie wirken, das Bemühen, die offensichtlichen Wirkunterschiede zu verstehen. In diesem Kontext habe ich mich gefragt, ob es sinnvoll sein kann, zwischen klassischen und Emulgatoren natürlichen Ursprungs zu unterscheiden. Für mich habe ich eine Entscheidung getroffen: ja.
Hier in diesem Austausch zwischen uns wird deutlich, dass eine klare Begriffsdefinition das A und O eines fruchtbaren Gesprächs ist, damit jeder weiß, was der andere meint.

Ich verwende den Begriff »natürlich« als Synonym für eine Stoffstruktur, die zwar u. U. isoliert vorliegt, jedoch in sich physiologischen, organischen Ursprungs ist. Das Gegenteil sind im Labor produzierte, zusammengestellte Substanzen, die in der Form nicht im natürlichen Verband existieren und auch nicht im Stoffwechsel so erzeugt werden. Insofern möchte ich ein Phospholipid schon irgendwie begrifflich von einem Glycerinstearat mit selbstemulgierendem Alkalistearat unterscheiden. Nur darum geht es mir, und ich bin mir bewusst, dass man das aus einer anderen Perspektive anders sehen kann oder muss. Wie die Kosmetikindustrie damit umgeht (auch die dermatologisch orientierte), ist
im Moment nicht mein Thema, analog dazu auch nicht der chemische Prozess der Herstellung. Daher würde ich diesen Aspekt in meinen Ausführungen hier gerne ausblenden (wohlwissend, dass Propylenglycol konserviert und eine DMS-Creme nicht emulgatorfrei ist, klar, und dass sowohl Lanolin als auch Reinlecithin mit dem romantischen Bild sanft blökender Schafe auf einer saftigen Wiese mit sich leise wiegenden Sojapflanzen im Hintergrund nicht viel gemein haben

).
Intakte Haut scheint keine Probleme mit Emulgatoren zu haben, und unsere klassischen Zuckeremus
sind in der Regel sehr gut verträglich; das ist meine Rede, seitdem ich mich ihnen eingehend gewidmet habe, auch gegen anders lautende Stimmen. Nicht intakte Haut, so meine Beobachtung, reagiert jedoch ausgesprochen positiv auf Substanzen, die ihr physiologisch und strukturell ähnlich sind; manchmal sind pflanzliche Pendants gegenüber tierischen verträglicher (Phytohormone, Phytosterole), da sie sich minimal von denen der menschlichen Physiologie unterscheiden und weniger als Fremdkörper erkannt und abgelehnt werden. Ob isoliert gewonnen oder im nativen oder raffinierten Produkt: meine Erfahrung ist, dass Lecithine (um ein Beispiel zu nennen), in hohem Maße vertragen werden, auch dann, wenn klassische Emulgatorsyteme zu Reaktionen führen. Daher rührt mein Bestreben, das in Begriffe zu packen. »Frei von klassischen Emulgatoren« – ich werde zusehen, dass ich das auf meiner Webseite so etikettiere, das passt besser. Eindeutig.

Anja hat geschrieben:Dann noch ein Wort zu den auf der Haut befindlichen Emulgatoren - die Frage ist doch - wieso benötigt unsere Haut denn _überhaupt_ Emulgatoren, die von außen zugeführt werden, wenn sie doch hauteigene Emulgatoren bereits in sich trägt.
Weil wir ein Substanz
gemisch zuführen, wäre meine These (also auch laut gedacht, Anja, nicht durch Quellen belegt): Lipide, Wasser, emulgierende Stoffe in einem Komplex, der gut aufgenommen wird – auch, wenn er, wie Wilma richtig bemerkt, auf der Haut »bricht« und in einer Weise metabolisiert wird, die wir kaum kontrolliert bestimmen können:
Wilma hat geschrieben:Bleiben die Mizellen, Liposomen, Bilayer & Co. dabei überhaupt intakt?
Nein, nicht zwingend. Es gibt Ergebnisse, nach denen Liposome als Fragmente über den Einbau und die erneute Abspaltung aus Zellmembranen tief in die Haut gelangen. Intakte Vesikel sind es zum Teil (großer, kleiner Teil? Ich habe da keine exakten Daten) nicht mehr, aber ihre grundsätzliche lamellare Struktur bleibt – das ist unter dem Elektronenmikroskop sichtbar. Es scheint für ihre Wirkung nach heutigen Erkenntnissen sekundär zu sein. Phospholipide, vor allem Phosphatidylcholin agiert mit der Haut aufgrund seiner strukturellen und chemischen Analogie; sie müssen nicht zwingend als geschlossene Vesikel vorliegen (wie im Oleogel spürbar).
Zurück zu Anjas Frage (» … wieso benötigt unsere Haut denn _überhaupt_ Emulgatoren, die von außen zugeführt werden, wenn sie doch hauteigene Emulgatoren bereits in sich trägt«), zu Pflegestrategien und wie man der Haut Substanzen anbieten kann:
Wasser alleine funktioniert nicht, Öl alleine nicht lange. Das Anbieten nacheinander klappt in der Regel nach meiner Beobachtung, wenn die Lipidmischung Sterole und Phospholipide enthält (wie in unseren Buttern), also hautphysiologisch verwandte emulgierende Substanzen (wobei ich von Pflegekonzepten rede, die dauerhaft sind … nicht von solchen, die phasenweise gezielt eingesetzt werden).
Es gibt Hautbilder, in denen die hauteigenen Emulgatoren ausgewaschen sind. Hier ist es schwierig, Stoffe so anzubieten, dass die Haut sie überhaupt nutzen kann. Wenn ich ein Öl auftrage, leisten die Fettsäuren eine gewisse Spreitung, aber der Kern wird durch die Sterole im Hydro-Lipid-Film umgesetzt, der zusammen mit dem Schweiß eine Emulsion bildet und für seine eigene Creme sorgt. Mein Bild ist, dass hautanaloge chemische Strukturen sich gut in einen solchen Prozess einbinden, da sie die lamellaren Strukturen des Cholesterins simulieren. Ich hoffe, ich kann dieses Bild vermitteln.
Regina hat geschrieben:Solte es daher nicht heissen, welche Öle, Fette etc. enthalten bereits genügend emulgierende Stoffe, um ohne separate Zugabe von Emus eine Emulsion zu erzeugen
Bei hoher Fettphase: ja. Jojobaöl beispielsweise, Buttern, in Kombi mit Wachsen … Tuâl sprach davon.

Was eben nicht gut geht: hohe Wasserphasen, da muss dann wieder ein Lecithin ran.
Anja hat geschrieben:Da ich mittlerweile glaube, dass wir mit der richtigen Pflege eine zufriedene Haut haben können, keinesfalls gegen das Alter ancremen können und Cremes auch keine Wunder vollbringen, geht mein Fokus mittlerweile weg von gehypten Rohstoffen, ist mein Streben nicht mehr geprägt von sehr großem Forscherdrang hinsichtlich der Zusammensetzung einer Creme, sondern es tendiert immer mehr dazu, mir meine Rohstoffe nach ethischen Gesichtspunkten auszuwählen.
Bei mir war der Prozess ein anderer: auch davon ausgehend, dass ich meine Haut in ihren Prozessen unterstützen, aber nicht jung cremen kann, hat mir gerade tiefes Verstehen vieler Zusammenhänge geholfen, erst gar nicht auf Wirkstoffpirsch zu gehen. Ich habe eine Handvoll an Substanzen für mich zusammen gestellt, die ich nachvollziehbar sinnvoll finde, davon verwende ich einige wenige, aber sie sind nicht sehr wichtig für mich. Das ist das, worin sich meine Abgrenzung zum klassischen Hobbythek-Konzept sehr deutlich zeigt, weil ich 80 % der dort verkauften Rohstoffe nie ausprobiert habe und mich das auch nicht interessiert. Die größte Entdeckung sind für mich die Öle gewesen und wie man mit ihnen arbeiten kann – und das möchte ich nicht mehr missen. Optimieren heißt für mich heute, meine Haut im Gleichgewicht zu halten, und dieses Spiel funktioniert mittlerweile sehr gut (wenn ich kein Konservierungsproblem habe).
Kurz zum Lyso:

Ich kenne Lysolecithine (also Lysophosphatidylcholine, um exakt zu sein) seit meiner Beschäftigung mit dieser Substanz und dem Versuch, an ein kosmetisch einsetzbares Produkt heranzukommen. Wir haben in unserem Körper und in unserer Haut Phospholipasen, die aus Phospholipiden Fettsäuren »abknipsen« – die Phospholipase A knipst, glaube ich die ungesättigte und Phospholipase B die gesättigte Fettsäure des Phosphatidylcholin-Moleküls ab (ich verwechsle die beiden schon mal). Das passiert in körpereigenen, sinnvollen Prozessen, in denen Zellmembrane aufgelöst werden sollen
und in pathologischen Prozessen. Der Hinweis auf das Lysophosphatidylcholin kam in dem Gespräch mit Dr. Lautenschläger von meiner Seite

, weil wir auch da unterscheiden mussten, wovon wir sprechen; es ist eben nicht das gleiche, ob ich vom Substanzgemisch spreche oder dem chemisch reinen hydrolisierten Molekül, an das ein Chemiker denkt. Bienen- und Schlangengift arbeitet übrigens teilweise mit diesem Prinzip: es enthält Phospholipasen, die die Phospholipide unserer Zellen auflösen, sie hydrolisieren, was bisweilen sehr ungesunde Auswirkungen hat. Reines Lysophosphatidylcholin würde ich nicht verwenden wollen. Ich würde auch ungerne reines Phosphatidylcholin einsetzen, weil es die Haut ebenfalls auf Durchlass stellt und stark austrocknen würde – nicht durch den Alkohol, wie oft gemeint, sondern durch das Phospholipid selbst, dass die Membrane flüssiger macht: wo Stoffe reinkommen, kommen auch bisweilen welche raus, ein logisches Prinzip, und ohne schützende Lipide wird's da kritisch. Am stabilsten scheinen Zellmebrane zu sein, wenn sie einen heterogenen Aufbau haben, und wir bieten mit unseren Emulsionen einen Mix an gesättigten, ungesättigten Fettsäuren, Phospholipiden und Sterolen an, der sehr fein auf unsere Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Das wäre meine Bitte an alle, die für sich sagen würden, dass sie von diesen Dingen wenig verstehen (was nicht schlimm ist, das tun die wenigsten): Bitte nicht isoliert beurteilen, sondern immer Zusammenhänge im Blick haben.
Spannend, ich mag solche Gespräche. Danke an Euch … nun bin ich gepannt auf weitere Gedanken. Die neuen Etiketten mache ich noch (die bei den Rezepten), aber das muss heute etwas warten.

Sterndie, es ist ein tolles Ölchen, aber der reine Lecithingehalt ist meines Wissens »unter ferner liefen« einzuordnen. Gamma-Linolensäure und Linolsäure sind die Werte, die es in die Waagschale wirft. Es hat einige unverseifbare Bestandteile (in Datenblättern stehen in der Regel so um 2 bis 2,5 %), aber dazu gehört nicht nur Lecithin.