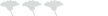Liebe Augenweide,
Augenweide hat geschrieben: ↑Donnerstag, 24. Dezember 2020, 14:51
Ich hab keine Ahnung. Ich hatte auch mal danach gegoogelt - aber um hier dahinterzusteigen, was die Wellenlängen, Lichtstärke, Lichtzusammensetzung angeht, müsstest du wahrscheinlich in ein einschlägiges Forum. Ich hab’s gelassen, weil ich den Platz nicht opfern möchte.
wenn ich darf, könnte ich dich ein bisschen aufschlauen, wenn nicht, einfach überlesen und runterscrollen:


Ganz grob gesprochen läuft die Photosynthese so ab, dass Photonen bestimmter Wellenlängen von den Farbzellen in den Blättern – vorwiegend Chlorophyll – absorbiert werden. Ihre elektromagnetische Energie wird dort in chemische Energie umgewandelt. Diesen Vorgang nennt man Lichtreaktion. Mit dieser chemischen Energie kann die Pflanze nun energiereiche, organische Verbindungen produzieren und diese als Baustoffe verwenden. Damit baut sie neue Blattzellen, Blüten, Früchte, Wurzeln etc. auf. Dieser Vorgang wird allerdings überhaupt erst in Schwung gebracht, sobald Photonen auf die Farbzellen treffen.
Pflanzen sind allerdings ziemlich wählerisch. Je nachdem, wie viel, wie lang und welches Licht auf sie trifft, gestaltet sich ihr Wachstum unterschiedlich.
So manches
Experiment hat bereits bewiesen, dass sich bestimmte Lichteinstellungen auf die Inhaltsstoffe von Blättern und Früchten der beleuchteten Pflanzen auswirken. Was es mit Intensität des Lichts, Beleuchtungsdauer und Lichteigenschaften auf sich hat, klären wir gleich.
Wenn du bis hierher durchgehalten hast, lohnt es sich weiter zu lesen:

Eine Pflanze, die – sagen wir einmal – im Mittelmeerraum Zuhause ist, hat einen anderen Lichtbedarf als Sträucher, die sich eher im Unterholz europäischer Wälder ansiedeln. Will man Pflanzen aufziehen bzw. künstlich beleuchten, muss man genau wissen, ob sie jeweils eher Freunde von direkter Sonneneinstrahlung oder Verschattung sind.
Was bei dem Interesse an mediterraner Kräuteraufzucht nun eindeutig ist, welche Wünsche diese Pflanzen haben. Aber bitte erst, wenn sie mehr als zwei Blättchen haben.
Die
Beleuchtungsdauer ist relativ schnell geklärt. Am besten funktioniert das, was schon jahrtausendelang gut funktioniert: der herkömmliche Tag-Nacht-Rhytmus, bei künstlicher Pflanzenbeleuchtung einfach durch einen Schalter oder Timer zu realisieren.
Bei der
Lichtintensität lohnt sich ein Blick auf die sogenannte Photonenflussdichte. Noch genauer gesagt handelt es sich dabei um die Dichte der Photonen photosynthetisch aktiver Strahlung. Es handelt sich bei der Angabe also um eine Quantifizierung des Lichts.
Die Einheit dafür wird in PPFD abgekürzt und in Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde (μmol/m2s) gemessen. Direkte Sonneneinstrahlung hat bis zu 2.000 μmol/m2s.
Nun ist es allerdings bei der natürlichen Pflanzenbeleuchtung in freier Wildbahn sehr selten, dass tatsächlich so eine hohe Dichte an photosynthetisch verwertbaren Photonen auf die Pflanzen treffen.
Wie hoch sollte also die Photonenflussdichte einer LED-Wachstumslampe sein?
Das ist abhängig vom Lichtbedarf der Pflanze. Hier kann also keine pauschale Antwort gegeben werden. Eine grobe Empfehlung ist eine durchschnittliche PPFD von 200 μmol/m2s. Eine zu hohe PPFD ist auch nicht förderlich, denn sie kann zu Lichtverbrennungen an der Pflanze führen.
Nun noch etwas zum
Lichtspektrum, der
Lichtfarbe. Bei der Lichtfarbe wird das Ganze schon etwas komplexer. Licht ist bekanntlich ein Teil der elektromagnetischen Strahlung. Das ist der Teil, der für den Menschen sichtbar ist. Er deckt sich auch in etwa mit dem Teil, der für die Photosynthese brauchbar ist. Aber eben nicht komplett. Mit dem Begriff Photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) wird der Bereich der elektromagnetischen Strahlung bezeichnet der bei Pflanzen die Photosynthese auslösen kann. Meist wird die PAR als Bereich zwischen 400 und 700 nm verstanden, jedoch ist bekannt, dass auch Strahlung unterhalb dieses Bereichs bis zu 360 nm und darüber bis 780 nm eine photosynthetische Reaktion bei Pflanzen hervorruft.
Bringen wir also die Farben ins Spiel. Eine spezifische Lichtstrahlung setzt sich aus unterschiedlichen Wellenlängen zusammen und bekommt dadurch eine bestimmte Farbe. Sind
die Wellenlängen eher hochfrequent, handelt es sich um den bläulichen Teil des Lichtspektrums, Langwellen sind eher am rötlichen Ende verortet.
Im Bereich um die 500 nm befinden sich die für uns grün wirkenden Wellenlängen. Treffen diese auf die GRÜNEN Pflanzen (Zellen und das darin enthaltene Chlorophyll), werden sie größtenteils reflektiert. Daher erscheinen die meisten Pflanzenblätter auch grün. Aus diesem Phänomen ergibt sich die sogenannte Grünlücke. Wird eine Pflanze ausschließlich mit dieser Wellenlänge bestrahlt, passiert weniger / kaum Photosynthese, da die Pflanzen diese nicht so gut nutzenkönnen.
Viele Hersteller künstlicher Pflanzenbeleuchtung gehen also nun dazu über, die grünen Wellenlängenanteile wegzulassen und in einer Mischung aus blauen und roten LEDs zu beleuchten. Das ist allerdings genauso kontraproduktiv, da sich die Photosynthese in diesem Bereich nicht gänzlich einstellt. Durch Carotinoide im Blattwerk findet eine Absorption der blaugrünen, kurzwelligeren Strahlung allerdings durchaus statt und besonders bei dunkelgrünen Blättern ist grünes Licht ebenso photosynthetisch aktiv – eine Spur von der eben erwähnten Grünlücke also.
Um es abzukürzen oder gar zu vertiefen, bietet sich diese Zusammenstellung an:
klick. Dort bekommst du nicht nur die Hintergründe, sondern auch gleich Lampenvergleich, wenn gewünscht.