Schöne Grüße
Repigmentierung der Haut
Moderator: Birgit Rita
-
Oana
Repigmentierung der Haut
liebe Leute .. war schon ewig nicht mehr hier und jetzt bin ich wieder mit einer Frage hier .... wie mein Betreff schon sagt - ist die Repigmentierung der Haut durch irgend ein äth. Öl möglich ??
Schöne Grüße
Schöne Grüße
-
Oana
hey .. danke für die Antwort 
nein, habe nur sehr alte und hässliche Narben auf den Schultern, wegen denen ich im Sommer nie Ärmelloses anziehen kann :-/
LG
nein, habe nur sehr alte und hässliche Narben auf den Schultern, wegen denen ich im Sommer nie Ärmelloses anziehen kann :-/
LG
-
Vortuna
Der Thread ist zwar schon älter, aber das würde mich auch interessieren.
Mein Bruder hat an der Augenbraue eine Stelle die sämtliche Pigmente verloren hat (auch die Haare der Augenbraue wurden stellenweise weiß).
Es stört ihn sehr, aber laut Hautärztin kann man nix machen, außer die Braue zu färben.
Mein Bruder hat an der Augenbraue eine Stelle die sämtliche Pigmente verloren hat (auch die Haare der Augenbraue wurden stellenweise weiß).
Es stört ihn sehr, aber laut Hautärztin kann man nix machen, außer die Braue zu färben.
-
angel
Also, meines Wissens (Habe meine DA über Haut geschrieben) gibt es da nichts. Leider. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren... 
Aber Pigmentstörungen haben viele, und sooo schlimm finde ich das gar nicht. Gehört halt zu der Person dazu! Muss eh nicht immer alles perfekt sein. Oder???
Aber Pigmentstörungen haben viele, und sooo schlimm finde ich das gar nicht. Gehört halt zu der Person dazu! Muss eh nicht immer alles perfekt sein. Oder???
- coboki
- Master of Emulsifying
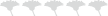
- Beiträge: 3425
- Registriert: Mittwoch, 11. Juni 2014, 22:38
- 11
- Wohnort: Niedersachsen
Liebe angel, da stimme ich Dir vollkommen zu!angel hat geschrieben: Muss eh nicht immer alles perfekt sein. Oder???
Meiner Meinung nach wird heutzutage viel zu sehr auf "Perfektionismus" in eher unwichtigen oder
nebensächlichen Dingen geachtet
Herzliche Grüße
Conny
Die Zeit ist immer reif, um das Richtige zu tun. (Martin Luther King)
Conny
Die Zeit ist immer reif, um das Richtige zu tun. (Martin Luther King)
-
angel
Hi Conny, ja, leider. Es ist ja jeder ein Individuum für sich!!! 
Obwohl ich mich selber auch bei der Nase nehmen muss: Ich kann auch eine ganz schöne Perfektionistin sein....
Aber ich habe mich gegen früher schon sehr gebessert. Weil ich auch lernen musste, dass nicht alles so geht wie vorgestellt... naja, das Alter macht halt weise.


Obwohl ich mich selber auch bei der Nase nehmen muss: Ich kann auch eine ganz schöne Perfektionistin sein....
Aber ich habe mich gegen früher schon sehr gebessert. Weil ich auch lernen musste, dass nicht alles so geht wie vorgestellt... naja, das Alter macht halt weise.

- Annika
- Master of Emulsifying
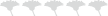
- Beiträge: 3197
- Registriert: Donnerstag, 15. Dezember 2011, 17:25
- 14
- Wohnort: Kaiserslautern
Da hab ich vor einiger Zeit ein Interview gelesen, das u.a. auch dieses Thema behandelt hat...coboki hat geschrieben:Meiner Meinung nach wird heutzutage viel zu sehr auf "Perfektionismus" in eher unwichtigen oder
nebensächlichen Dingen geachtet
Gefunden, hier, ich fand es lesenswert
LG Annika
-
becksgold
- Rohstoffqueen
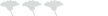
- Beiträge: 506
- Registriert: Samstag, 3. Dezember 2011, 21:34
- 14
- Wohnort: Leipzig
ich habe auch Vitiligo, sprich Pigmentstörungen - und es ist mittlerweile doch recht weit ausgebreitet. Ganz ehrlich? es gibt Schlimmeres. Mein Stiefvater hat z.B. böse Neurodermitis und ist gegen allerlei Zeugs allergisch, der hat viel mehr Probleme als ich mit meinen weißen Flecken. ganz selten spricht mich mal jemand darauf an - es stört mich nicht. Im Gesicht decke ich es mit Make-Up ab, und auf den Händen sieht man es jetzt im Winter kaum.
eigentlich mehr aus Neugierde möchte ich es doch mal mit Wirkstoffölen ausprobieren. Ich glaube allerdings nicht, dass es irgendwas verändert
eigentlich mehr aus Neugierde möchte ich es doch mal mit Wirkstoffölen ausprobieren. Ich glaube allerdings nicht, dass es irgendwas verändert
liebe Grüße
Rebecca
Rebecca
- coboki
- Master of Emulsifying
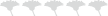
- Beiträge: 3425
- Registriert: Mittwoch, 11. Juni 2014, 22:38
- 11
- Wohnort: Niedersachsen
Ich lach mich weg....angel hat geschrieben:Aber ich habe mich gegen früher schon sehr gebessert. Weil ich auch lernen musste, dass nicht alles so geht wie vorgestellt... naja, das Alter macht halt weise.

Ich denke halt, das viele Menschen dort Perfektionismus anstreben, wo er meiner Meinung nach überflüssig ist. Aber wie Du schon richtig schreibst: jeder ist ein Individuum.
Herzliche Grüße
Conny
Die Zeit ist immer reif, um das Richtige zu tun. (Martin Luther King)
Conny
Die Zeit ist immer reif, um das Richtige zu tun. (Martin Luther King)
- coboki
- Master of Emulsifying
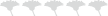
- Beiträge: 3425
- Registriert: Mittwoch, 11. Juni 2014, 22:38
- 11
- Wohnort: Niedersachsen
Danke, liebe AnnikaAnnika hat geschrieben: Da hab ich vor einiger Zeit ein Interview gelesen, das u.a. auch dieses Thema behandelt hat...
Gefunden, hier, ich fand es lesenswert.
Ich habe es gerade gelesen und finde es sehr interessant. Es steckt, wie ich finde, viel Wahrheit in den Aussagen.
Herzliche Grüße
Conny
Die Zeit ist immer reif, um das Richtige zu tun. (Martin Luther King)
Conny
Die Zeit ist immer reif, um das Richtige zu tun. (Martin Luther King)
-
angel
Hi Rebecca, na, da bin ich dann mal auf die Ergebnisse deiner Studie gespannt!!!!eigentlich mehr aus Neugierde möchte ich es doch mal mit Wirkstoffölen ausprobieren. Ich glaube allerdings nicht, dass es irgendwas verändert
Stimmt, meine Freundin hat auch Vitiligo, und weder sie noch die Umgebung stören sich daran.
Da ist Neurodermitis schon was richtig Ernstes. Ich habe es gottseidank selber nicht. Es gibt dazu ja unzählige Theorien und Studien, die sich nur leider allzuoft widersprechen in ihrer Aussage. Mein Ergebnis beim Durchforsten dieser Studien war, dass sich eine zu hygienische Einstellung, ein hoher Bildungsstand und eine zu übertriebene Ernährungsphilosophie im Hinblick auf gesunde Ernährung negativ auswirken auf die Haut. Da gab es z.B. eine Studie, die hieß "Eat dirt and avoid atopic dermatitis". Aber, wie gesagt, das ist wieder auch nur eine Meinung, und jemanden, der darunter leidet, hilft weder das eine noch die andere weiter. Da muss man leider selber einen Weg finden, wie man damit umgeht. Damit es auch hilft. Man weiß eigentlich kaum was darüber, außer, dass Cortisol hilft. Und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn das macht ja die Haut auf Dauer dünn.
-
angel
Hi Conny, ja und gerade in unserer heutigen Zeit, in der ja Individualismus nicht mehr soo akzeptiert wird wie z.B. in den 70ern, ist ein gewisser Mut zum Individuellen schon Gold wert. Traut sich eh fast keiner mehr!!Ich lach mich weg....
Ich denke halt, das viele Menschen dort Perfektionismus anstreben, wo er meiner Meinung nach überflüssig ist. Aber wie Du schon richtig schreibst: jeder ist ein Individuum.
- Rosemarie
- Master of Emulsifying
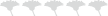
- Beiträge: 3998
- Registriert: Mittwoch, 10. Dezember 2014, 16:21
- 11
- Wohnort: 600 üN
Deswegen sind wir ja hier - wir trauen uns!angel hat geschrieben:Hi Conny, ja und gerade in unserer heutigen Zeit, in der ja Individualismus nicht mehr soo akzeptiert wird wie z.B. in den 70ern, ist ein gewisser Mut zum Individuellen schon Gold wert. Traut sich eh fast keiner mehr!!Ich lach mich weg....
Ich denke halt, das viele Menschen dort Perfektionismus anstreben, wo er meiner Meinung nach überflüssig ist. Aber wie Du schon richtig schreibst: jeder ist ein Individuum.
viele Grüße
Rosemarie
Rosemarie
- Helga
- Moderator
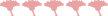
- Beiträge: 24813
- Registriert: Samstag, 25. August 2007, 22:37
- 18
- Wohnort: Traun/Oberösterreich
Von wegen nicht interessantAngel hat geschrieben: Das ist mein Lieblingsthema, da könnte ich ewig schreiben, aber eben soo interessant auch wieder nicht. Ich wollte nur meinen Senf auch dazugeben....
wer weiss schon was die Zukunft bringt;
mach am besten schon mal ein Küberl Senf auf
Liebe Grüße und noch einen schönen Tag :-)
Helga
Helga
-
angel
Ich mache also "ein Küberl Senf auf"  , und schreibe was über die Geschichte des Ekzems:
, und schreibe was über die Geschichte des Ekzems:
Achtung, ROMAN!!!
Der Begriff „Ekzem“ ist über 2000 Jahre alt und stammt aus der griechischen Medizin. Ekzeme zählen heute zu den häufigsten und wichtigsten Hauterkrankungen. In der Antike wurden Hauterkrankungen als Ablagerungen ausgehend von internen Fehlfunktionen verstanden. Diese sollten auf keinen Fall radikal geheilt werden, da sie sonst „zurückschlagen“ würden. Auch eine ungeeignete Ernährung wurde als Ursache angesehen. Die Therapie beschränkte sich in der damaligen Zeit auf äußerliche Heilmittel wie Öle, Salben und Salzwasser. Da jedoch die Beschreibung der unterschiedlichen Dermatosen in früheren Werken der Kinderheilkunde nicht sehr genau ist, und dadurch eine klare Abgrenzung der einzelnen Krankheitsbilder untereinander schwer fällt, lässt sich die atopische Dermatitis kaum einordnen. Das Ekzem wird nicht getrennt von anderen Dermatosen, und wenn es überhaupt als eigenständige Erkrankung erwähnt wird, dann nur am Rande (vgl. das Asthma bronchiale, welches bei infektiösen und akuten Lungenerkrankungen angeführt wird).
Dieser Umstand führt zur Bezeichnung der verschiedensten Erscheinungsformen der Erkrankung als „Ekzeme“. In diese Kategorie fallen auch zum Beispiel Skabies, Hautinfektionen wie Staphylodermien und vor allem seborrhoische Dermatitiden. Selbst die Tuberkulose wird mit einer Ekzemerkrankung verwechselt.
Das Ekzem an sich jedoch, definiert durch seine problematische Symptomatik mit Juckreiz, sichtbaren Hautveränderungen und der Beeinträchtigung der ganzen Familie, findet sich in keinem Buch der Kinderheilkunde der damaligen Zeit beschrieben.
Im 18. Jahrhundert taucht die „unechte Krätze“ in einem Lehrbuch auf, die nicht unbedingt mit der atopischen Dermatitis vergleichbar ist. Am Anfang des 19. Jahrhunderts entsteht dann die erste exakte klinische Beschreibung der Erkrankung unter Verwendung des Ekzem-Begriffes. Gemeint sind damit nur Erkrankungen, die durch äußere Einflüsse entstanden sind. Eine erste genaue klinische Beschreibung des Ekzems ist 1808 zu finden, wobei als Ursache nur äußere Faktoren angesehen werden. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wird zwischen „akuten (= durch äußere Einflüsse hervorgerufene) und chronischen (= ohne erkennbare Ursache entstehende) Ekzemen“ unterschieden.
1833 findet sich schließlich eine exakte Beschreibung des Ekzems, hier wird es auch klar von anderen Dermatosen getrennt. Akute, durch unspezifische Auslöser hervorgerufene, sowie chronische Ekzeme werden unterschieden und deren Verlauf in den unterschiedlichen Altersstufen ist beschrieben.
Die ersten Vermutungen in Bezug auf die Ätiologie und Therapie der „chronischen nichtinfektiösen Ausschläge bei Säuglingen und Kleinkindern“ betreffen die Ernährung. 1857 wird erstmals die Schwierigkeit einer schnellen Heilung des „zumal das Gesicht entstellenden Ausschlages“ der Kinder und die damit verbundene Ungeduld, die zu Interaktionsschwierigkeiten zwischen Patient, Familie und Arzt führen, beklagt.
Neue Erkenntnisse zu den Ursachen tauchen um die Jahrhundertwende auf. „Brocq“ führt im Jahr 1896 die Bezeichnung „Neurodermitis“ ein, und versteht darunter in erster Linie eine (vermutete) „Imbalance des vegetativen Nervensystems“. Mögliche psychische Faktoren werden erst viel später diskutiert, wo dann die Neurodermitis geradezu mit „Psychodermitis“ gleichgesetzt wird, also als Ausdruck seelischer Not beziehungsweise psychischer Auffälligkeit verstanden wird. Diese vermeintliche Beziehung zum Nervensystem entstand einfach durch einen Bedeutungswandel, denn ursprünglich war das vegetative Nervensystem gemeint. Selbst Therapeuten nehmen dies nur selten zur Kenntnis.
Mehr Augenmerk richtet sich auf die Beobachtung, dass Ekzemschübe durch bestimmte Nahrungsmittel ausgelöst werden können. 1905 prägt „von Pirquet“ den Begriff „Allergie“, was in weiterer Folge zur Definition von allergischen Auslösern für Ekzeme führt. Vor allem in Laienkreisen kommen Hinweise auf spezielle Ekzemdiäten zur Sprache.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Ekzem vielfach als Symptom einer Konstitutionsanomalie beschrieben, die durch einen „Überfluss der Nahrungsstoffe“, ausgelöst durch ein Missverhältnis von Nahrungsaufnahme und Stoffverbrauch, verursacht wird. In den folgenden Jahren entwickelt sich die Allergologie rasch weiter. Zwischen 1920 und 1930 gelingt der Nachweis der „Reagine“ genannten Antikörper, was die Frage einer Sensibilisierung beim Stillen aufklärt.
Unter Pädiatern galt demnach eine allergische Genese der atopischen Dermatitis bald als gesichert, und die wichtigsten (Nahrungsmittel-)Allergene waren bekannt.
Dieser rasante Aufschwung in der Allergologie führte zunächst dazu, dass das Ekzem im weiteren Verlauf als rein allergische Krankheit angesehen wurde. „Woringer“ (1943) jedoch verweist erstmals auch auf die Heredität der atopischen Dermatitis und auf unspezifisch verschlimmernde Reize.
Erst ab den 60er Jahren wuchs das Interesse an der Erkrankung enorm. Vor allem in den letzten Jahrzehnten sind weltweit unzählige Studien speziell zu den immunologischen und allergischen Ursachen ins Leben gerufen und Forschungen zu neuen therapeutischen Ansätzen angestrebt worden.
Vor dem Hintergrund einer in den letzten Jahren in der industrialisierten Welt wiederholt beschriebenen, nahezu epidemischen, Zunahme der atopischen Erkrankungen überhaupt und der atopischen Dermatitis bei Kindern im Speziellen, und damit der Entwicklung zu einem volksgesundheitlichen Problem, entsteht - neben dem Interesse an der Feststellung der tatsächlichen Prävalenz in der Bevölkerung - ein noch ausgeprägteres Interesse an der Erforschung von Ursachen und Risikofaktoren für diese Erkrankung und möglichen Einflussfaktoren, da diese bis jetzt noch immer weitgehend unklar sind. Lediglich ein ursächlicher Zusammenhang mit Umweltschadstoffen wurde oft strittig in der Öffentlichkeit vertreten.
ROMAN Ende.
Achtung, ROMAN!!!
Der Begriff „Ekzem“ ist über 2000 Jahre alt und stammt aus der griechischen Medizin. Ekzeme zählen heute zu den häufigsten und wichtigsten Hauterkrankungen. In der Antike wurden Hauterkrankungen als Ablagerungen ausgehend von internen Fehlfunktionen verstanden. Diese sollten auf keinen Fall radikal geheilt werden, da sie sonst „zurückschlagen“ würden. Auch eine ungeeignete Ernährung wurde als Ursache angesehen. Die Therapie beschränkte sich in der damaligen Zeit auf äußerliche Heilmittel wie Öle, Salben und Salzwasser. Da jedoch die Beschreibung der unterschiedlichen Dermatosen in früheren Werken der Kinderheilkunde nicht sehr genau ist, und dadurch eine klare Abgrenzung der einzelnen Krankheitsbilder untereinander schwer fällt, lässt sich die atopische Dermatitis kaum einordnen. Das Ekzem wird nicht getrennt von anderen Dermatosen, und wenn es überhaupt als eigenständige Erkrankung erwähnt wird, dann nur am Rande (vgl. das Asthma bronchiale, welches bei infektiösen und akuten Lungenerkrankungen angeführt wird).
Dieser Umstand führt zur Bezeichnung der verschiedensten Erscheinungsformen der Erkrankung als „Ekzeme“. In diese Kategorie fallen auch zum Beispiel Skabies, Hautinfektionen wie Staphylodermien und vor allem seborrhoische Dermatitiden. Selbst die Tuberkulose wird mit einer Ekzemerkrankung verwechselt.
Das Ekzem an sich jedoch, definiert durch seine problematische Symptomatik mit Juckreiz, sichtbaren Hautveränderungen und der Beeinträchtigung der ganzen Familie, findet sich in keinem Buch der Kinderheilkunde der damaligen Zeit beschrieben.
Im 18. Jahrhundert taucht die „unechte Krätze“ in einem Lehrbuch auf, die nicht unbedingt mit der atopischen Dermatitis vergleichbar ist. Am Anfang des 19. Jahrhunderts entsteht dann die erste exakte klinische Beschreibung der Erkrankung unter Verwendung des Ekzem-Begriffes. Gemeint sind damit nur Erkrankungen, die durch äußere Einflüsse entstanden sind. Eine erste genaue klinische Beschreibung des Ekzems ist 1808 zu finden, wobei als Ursache nur äußere Faktoren angesehen werden. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wird zwischen „akuten (= durch äußere Einflüsse hervorgerufene) und chronischen (= ohne erkennbare Ursache entstehende) Ekzemen“ unterschieden.
1833 findet sich schließlich eine exakte Beschreibung des Ekzems, hier wird es auch klar von anderen Dermatosen getrennt. Akute, durch unspezifische Auslöser hervorgerufene, sowie chronische Ekzeme werden unterschieden und deren Verlauf in den unterschiedlichen Altersstufen ist beschrieben.
Die ersten Vermutungen in Bezug auf die Ätiologie und Therapie der „chronischen nichtinfektiösen Ausschläge bei Säuglingen und Kleinkindern“ betreffen die Ernährung. 1857 wird erstmals die Schwierigkeit einer schnellen Heilung des „zumal das Gesicht entstellenden Ausschlages“ der Kinder und die damit verbundene Ungeduld, die zu Interaktionsschwierigkeiten zwischen Patient, Familie und Arzt führen, beklagt.
Neue Erkenntnisse zu den Ursachen tauchen um die Jahrhundertwende auf. „Brocq“ führt im Jahr 1896 die Bezeichnung „Neurodermitis“ ein, und versteht darunter in erster Linie eine (vermutete) „Imbalance des vegetativen Nervensystems“. Mögliche psychische Faktoren werden erst viel später diskutiert, wo dann die Neurodermitis geradezu mit „Psychodermitis“ gleichgesetzt wird, also als Ausdruck seelischer Not beziehungsweise psychischer Auffälligkeit verstanden wird. Diese vermeintliche Beziehung zum Nervensystem entstand einfach durch einen Bedeutungswandel, denn ursprünglich war das vegetative Nervensystem gemeint. Selbst Therapeuten nehmen dies nur selten zur Kenntnis.
Mehr Augenmerk richtet sich auf die Beobachtung, dass Ekzemschübe durch bestimmte Nahrungsmittel ausgelöst werden können. 1905 prägt „von Pirquet“ den Begriff „Allergie“, was in weiterer Folge zur Definition von allergischen Auslösern für Ekzeme führt. Vor allem in Laienkreisen kommen Hinweise auf spezielle Ekzemdiäten zur Sprache.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Ekzem vielfach als Symptom einer Konstitutionsanomalie beschrieben, die durch einen „Überfluss der Nahrungsstoffe“, ausgelöst durch ein Missverhältnis von Nahrungsaufnahme und Stoffverbrauch, verursacht wird. In den folgenden Jahren entwickelt sich die Allergologie rasch weiter. Zwischen 1920 und 1930 gelingt der Nachweis der „Reagine“ genannten Antikörper, was die Frage einer Sensibilisierung beim Stillen aufklärt.
Unter Pädiatern galt demnach eine allergische Genese der atopischen Dermatitis bald als gesichert, und die wichtigsten (Nahrungsmittel-)Allergene waren bekannt.
Dieser rasante Aufschwung in der Allergologie führte zunächst dazu, dass das Ekzem im weiteren Verlauf als rein allergische Krankheit angesehen wurde. „Woringer“ (1943) jedoch verweist erstmals auch auf die Heredität der atopischen Dermatitis und auf unspezifisch verschlimmernde Reize.
Erst ab den 60er Jahren wuchs das Interesse an der Erkrankung enorm. Vor allem in den letzten Jahrzehnten sind weltweit unzählige Studien speziell zu den immunologischen und allergischen Ursachen ins Leben gerufen und Forschungen zu neuen therapeutischen Ansätzen angestrebt worden.
Vor dem Hintergrund einer in den letzten Jahren in der industrialisierten Welt wiederholt beschriebenen, nahezu epidemischen, Zunahme der atopischen Erkrankungen überhaupt und der atopischen Dermatitis bei Kindern im Speziellen, und damit der Entwicklung zu einem volksgesundheitlichen Problem, entsteht - neben dem Interesse an der Feststellung der tatsächlichen Prävalenz in der Bevölkerung - ein noch ausgeprägteres Interesse an der Erforschung von Ursachen und Risikofaktoren für diese Erkrankung und möglichen Einflussfaktoren, da diese bis jetzt noch immer weitgehend unklar sind. Lediglich ein ursächlicher Zusammenhang mit Umweltschadstoffen wurde oft strittig in der Öffentlichkeit vertreten.
ROMAN Ende.
-
angel
Hi Heike Blümgrün, ja, danke (fürs Lesen des Romans!!!! 
 ) Ich wollte, wenn überhaupt, was allgemeines schreiben, da ich glaube, dass es jeden Neurodermitis-Geplagten nervt, wieder neue Ansätze und Risikofaktoren zu hören. Da ist konkretere Hilfe - wie eine richtig Creme dafür - schon besser. Aber das kann ich noch lange nicht, dass ich selber eine Creme zusammenstelle. Ich rühre nur nach.
) Ich wollte, wenn überhaupt, was allgemeines schreiben, da ich glaube, dass es jeden Neurodermitis-Geplagten nervt, wieder neue Ansätze und Risikofaktoren zu hören. Da ist konkretere Hilfe - wie eine richtig Creme dafür - schon besser. Aber das kann ich noch lange nicht, dass ich selber eine Creme zusammenstelle. Ich rühre nur nach. 
-
angel
Gern geschehen!! Dass das jemanden außer mich interessiert... 
-
Oana
so ... war jetzt schon länger nicht mehr im Forum und muss jetzt feststellen, dass mein Thema irgendwie ein Eigenleben entwickelt hat, das nichts mehr mit meinen Narben zutun hat  ..
..
wollte ja nur wissen, ob ich meine weißen Narben irgendwie wieder durch ätherische Öle, oder sonstige Naturprodukte "färben" kann - aber es gibt wohl wirklich noch nichts hilfreiches zu dem Thema :-/
aber unterhaltet euch ruhig weiter über andere Themen
schöne Grüße .. Oana
wollte ja nur wissen, ob ich meine weißen Narben irgendwie wieder durch ätherische Öle, oder sonstige Naturprodukte "färben" kann - aber es gibt wohl wirklich noch nichts hilfreiches zu dem Thema :-/
aber unterhaltet euch ruhig weiter über andere Themen
schöne Grüße .. Oana
-
angel
Liebe Oana, ich zumindest weiß nichts über ÄÖ, mit denen man Narben färben kann. Mit Make Up hast du es sicher schon versucht?
Da gibt es ja so spezielle Narbensalben und dergleichen, ich habe sie noch nie versucht, aber meine Freundin hat so ziemlich alle durchprobiert. Sie meinte, dass nichts hilft.
Ich hoffe, es kommen noch kompetentere und spezifischere Tipps!!
Da gibt es ja so spezielle Narbensalben und dergleichen, ich habe sie noch nie versucht, aber meine Freundin hat so ziemlich alle durchprobiert. Sie meinte, dass nichts hilft.
Ich hoffe, es kommen noch kompetentere und spezifischere Tipps!!
-
Oana
hallo Angel - vielen dank für die Antwort
ja, probiert habe ich schon sogut wie alles .. auch Camouflage-Make-up .. hilft alles nix ....
naja, dann weiterhin langärmlige Shirts tragen und alles ist gut
LG
ja, probiert habe ich schon sogut wie alles .. auch Camouflage-Make-up .. hilft alles nix ....
naja, dann weiterhin langärmlige Shirts tragen und alles ist gut
LG

